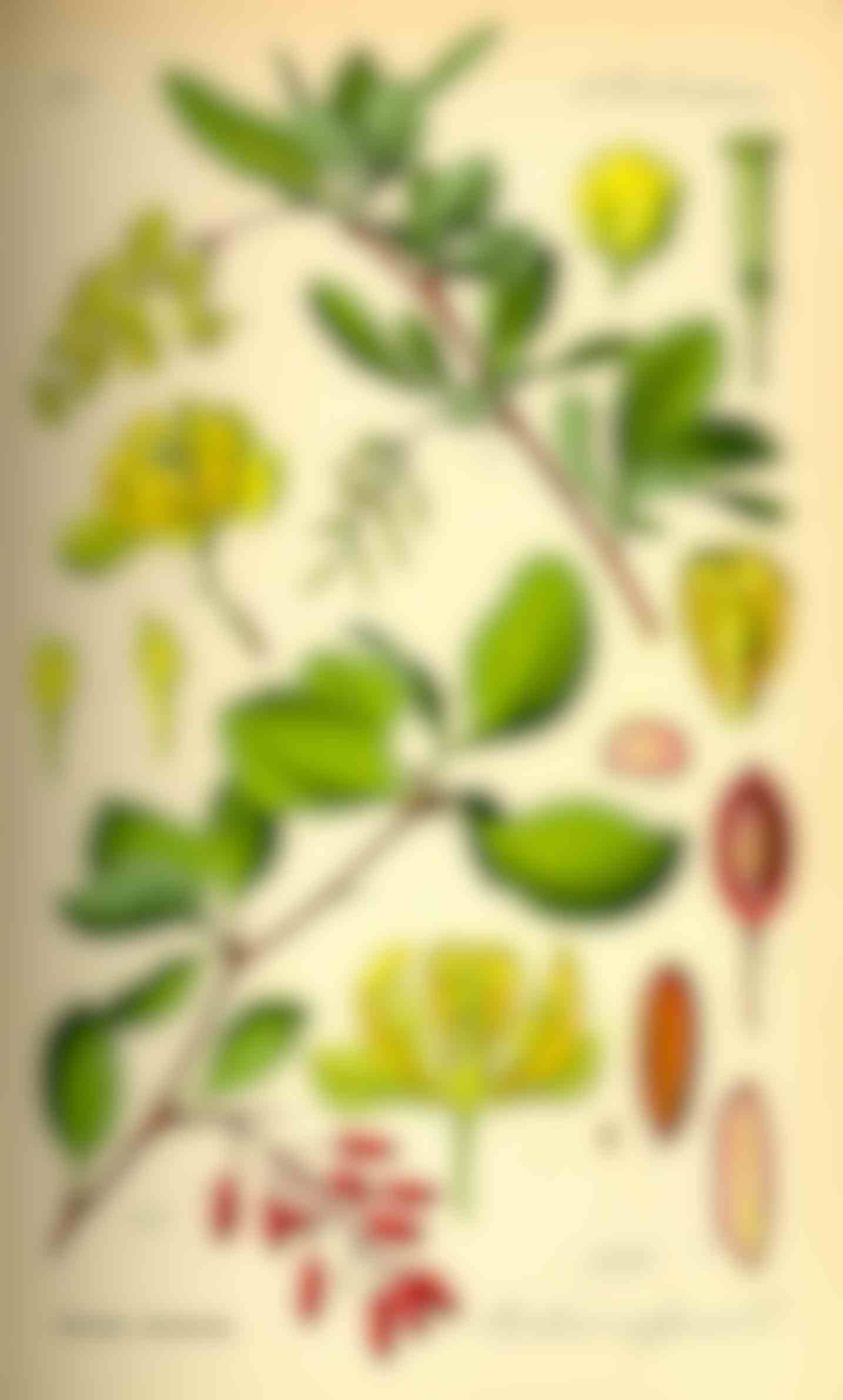Sie klingt exotisch und taucht heute auch kaum mehr in der heimischen Küche auf, die Berberitze, die in der Schweiz über Jahrhunderte als Sauerdorn-Beere sehr vielseitig genutzt wurde. Regelmässig findet man sie heute jedoch nur noch in orientalischen Reisgerichten, insbesondere in solchen aus dem Iran oder gelegentlich auch aus der Türkei. Dabei ist die rötliche Berberin auch in der Schweiz ein heimisches Pflänzchen, das über Jahrhunderte nicht nur zur Herstellung von Marmeladen diente, sondern oft auch dazu, Quittenmarmelade oder Apfelmus rötlich einzufärben. In alten Schweizer Kochbüchern taucht die Berberis vulgaris, wie sie auf lateinisch heisst, bis zirka um 1870 noch regelmässig auf, bis sie fast vollständig aus den Küchen und damit auch aus dem Bewusstsein verschwindet.
Nicht, dass man sie in der Küche nicht mehr haben wollte: sie verschwand, weil man begann, ihr in der Natur den Garaus zu machen. Denn im 19. Jahrhundert erkannte man, dass sie als Zwischenwirt für eine in der Landwirtschaft gefürchtete Krankheit dient, den Getreideschwarzrostpilz. Ein Pilz, der mitverantwortlich gemacht wurde für grosse Ernteausfälle bei Getreide. Also rottete man sie aus, insbesondere in allen Getreideanbaugegenden des Schweizer Mittellandes – aber auch in Frankreich und den USA fanden grossflächige Aktionen zur Beseitigung dieser einst beliebten Hecken- und Nutzpflanze statt.
Zu finden ist sie deshalb heute wild fast nur noch in Graubünden und anderen abgelegenen Seitentälern unserer Nachbarländer, wo der einst bis über die Baumgrenze hinaus praktizierte Getreideanbau schon ein Jahrhundert zuvor fast vollständig aufgegeben wurde. Das zeigt etwa auch die Vielzahl an Trivialnamen, mit denen die Bündnerinnen und Bündner diese Beere einst bezeichneten: Bettlerkraut hiess es, Erbselnwurz, Gälhügel, Geissblatt, Rifspitzbeere, Spitezbeere oder im Engadin auch Spinatsch. Und auch in jenen Gegenden des Wallis und der Ostschweiz, in denen heute noch bescheidene wilde Bestände zu finden sind, wurde sie mit faszinierenden Namen bezeichnet: Frauenasuampfara in St. Gallen etwa, Reifbeere in Schaffhausen und Saurauch und Schwidere im Wallis. Wild sammeln lässt sie sich heute in diesen Gegenden noch immer, wenn man die Plätze kennt, an denen sie gedeiht.
Käuflich erwerben lassen sich die länglichen, roten Beeren im getrockneten Zustand insbesondere in türkischen und orientalischen Läden und bei Delikatesshändlern. Was sich lohnt, insbesondere wenn man häufig bäckt oder ebenso häufig Rosinen, Sultaninen oder Korinthen in der Küche nutzt, die sich alle durch Berberitzen ersetzen lassen. Selber habe ich sie schon im Birnenbrot verbacken, in Guggelhöpfen oder in anderen süssen Hefeteiggebäcken. Wunderbar passen sie mit ihrer fruchtigen Säure aber auch in Fleischgerichte, etwa zu Lamm oder zu Gitzi, jederzeit aber auch zu einfacheren Gerichten, etwa mit Brotcroutons vermischt über Blattsalate gestreut.
In kleinen Mengen nutzen lassen sich aber auch die zarten Blätter des Berberitzenstrauches, die sich geschmacklich nur dadurch von den Beeren unterscheiden, dass ihnen der Fruchtzucker fehlt. Bei der Bündner Bio-Bäuerin Sabina Heinrich in Filisur im Albulatal habe ich kürzlich ein wundervolles Gebäck im Hofladen gefunden: kleine Bündner Grissini mit eingebackenen Berberitzenblättern. Die wundervoll zum Traubenkirschblüten-Sirup gepasst haben, den sie ebenfalls aus selbst gesammelten Wildblüten hergestellt hat. Doch darüber mehr in einer späteren Kolumne.